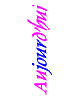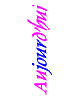Point de vue virtuelle 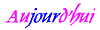
Anne Schäfer-Junker, Berlin
Die Ursprünge meiner Entdeckung des Lichtes
Als Kind streifte ich oft mit meinem Vater durch die Thüringer Wälder und Berge. In den Tälern und auf den Wiesen verweilten wir bei unseren Wanderungen meistens an den spiegelklaren Seen und fischreichen Flüssen, wo uns die kräftigen Sonnenstrahlen wärmten.
Meine Mutter, die zu Hause blieb, schenkte mir mein erstes Buch. Es hieß Der Wundermantel, von Ferenc Móra*, einem ungarischen Schriftsteller (im Original-Titel: Kincskeresö kisködmön). In diesem Buch wohnte eine Fee in einem bestickten Leder-Mantel, den ein kleiner Hirten-Junge geschenkt bekam. Ich las das Buch mit innigster Begeisterung, Seite für Seite bis in die Nacht hinein - mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Ich war glücklich, daß die Taschenlampe Licht gab und ich das Verbot nachts zu lesen, umgehen konnte.
Da meine Mutter Schneidermeisterin war, muß sie mir dieses Buch mit naivem Bedacht ausgewählt haben – sie nähte mir und meiner Schwester oft neue Kleider und manchmal auch einen Mantel. Natürlich war nun klar, daß diese Kleidungsstücke alle Zauberkraft besaßen, wenn sie auch nicht von einem Hirten kamen, wie das Wundermäntelchen, denn sie strahlten jedes Mal, wenn wir sie des Morgens an unseren Betten fanden.
Möglicherweise hat mich sogar dieses Buch eines ungarischen Kürschnerjungen (Ferenc Móras Vater war Kürschner) dazu gebracht, später während meines Philosophie-Studiums an der Friedrich-Schiller-Universität Jena vier Semester Ungarisch und viele ungarische Lieder zu lernen.
Doch zurück zur Zauberkraft der Kleider in meiner Kindheit. Wohl erwachte ich ab und an sehr früh aus Neugier, in den Strahlen der Morgensonne, wenn sie leise auf mein Bett fielen, weil ein durch die Mutter versprochenes neues zart-rosafarbenes oder sonstwie farbiges Kleid an meinem Bett lag. Und fortan glaubte ich an die kleinen strahlenden Sterne und Lichtwellen, die die Fee aus dem Mantel des kleinen Hirtenjungen aussandte und die natürlich ebenso meinen Kleidern und Mänteln innewohnen mußten, auch wenn ich ein Mädchen war und mit dem Wundermäntelchen eigentlich ein Junge beschenkt worden war.
Die Kleider sahen manche Kinder in meiner Schulklasse immer mit leuchtenden Augen an, mit strahlenden Augen. Und ich fand, daß auch ihre Augen voller Licht waren. Vielleicht wurde ich um die schönen Kleider beneidet, wenn diese Augen so strahlten? Aber davon merkte ich damals nicht sehr viel. Erst als mir später eine ehemalige Mitschülerin diese Beobachtungen erzählte, begriff ich, was in den anderen Mädchen vorgegangen sein könnte.
Natürlich blieben die schönen Kleider zu Hause, wenn wir Angeln gingen und durch die Wiesen strolchten mit dem Vater. Doch dafür gab es Entdeckungen, von denen wir vorher nichts wußten. Am spannendsten waren die Übernachtungen am Fluß. Das Zelt war ungemütlich und selten biß nachts ein Fisch, so daß wir eigentlich nicht richtig schliefen oder schon im kühlen Morgengrau geweckt wurden – von den Frühnebeln über den Feldern, vom Morgentau auf den Kuh-Wiesen und den milchigen, aber kühlen Sonnenaufgängen.
Ab und an gab es auch strahlende, wärmende Sonnenaufgänge und so lernte ich ein neues Licht kennen und hatte fortan Sehnsucht danach. Noch aber wußte ich nicht, wie man dieses Licht einfangen konnte. Ich hatte zwar schon öfter photographische Aufnahmen gesehen, die mich als Kind zeigten und auch gedruckt waren in einer Thüringer Zeitung. Aber diese waren schwarz-weiß und strahlten nicht. Und natürlich verstand ich nicht wie das möglich war. Lediglich wußte ich, daß im Schrank meiner Mutter eine alte Box lag, die sie Photoapparat nannte und in die sie manchmal einen sogenannten Rollfilm einlegte und dann einfach einen Hebel herunterzog, an einer Kurbel drehte und das nächste unsichtbare Bild „festhielt“, wenn wir spazieren gingen. Eines Tages kamen dann Papiere der Größe 6 x 9 cm aus einer Drogerie, auf denen wir uns, die Eltern und unsere Schäferhündin wiedersahen, oder anders ausgedrückt, auf denen wir zu sehen waren. Die Kanten der Papierbilder waren fein säuberlich mit Rundungen gerändert. Später wurden sie in ein Photoalbum eingesteckt. Das war besonders anstrengend, da man Photoecken aufkleben mußte und der Kleber ständig an den Fingern haften blieb. Aber das alles erklärte nicht, wie es dazu kam, daß wir uns auf dem Papier sehr klein sehen konnten.
Dieses für uns Kinder unergründliche Geheimnis, wie wir einfach verkleinert und in Schwarz-Weiß-Grau-Tönen auf dieses Papier kamen ließ mir keine Ruhe. Meine Neugierde wuchs und wurde beflügelt, immer wieder neue Versuche zu machen, Licht zu sehen und Belichtetes einzufangen mit einer „Blackbox“. Erst später lernte ich, daß und warum optische Linsen erforderlich sind, um Schärfen und Entfernungen einzustellen und nach und nach war nicht mehr ich die Entdeckung auf einem Stück Papier sondern ich begann die Welt um mich herum zu untersuchen und zu entdecken, indem ich durch die Blackbox schaute und glaubte, alles festhalten zu müssen was ich sah.
Und erst sehr viel später, als ich die ersten Farbphotos gesehen hatte, glaubte ich, daß Goethes Farbkreis ein Regenbogen auf einem Farbphoto gewesen sein mußte Und nun wollte ich das Licht nur noch in Farben einfangen, um Regenbögen auf dem Papier festzuhalten. Plötzlich war alles was mir begegnete ein Regenbogen und alles was ich sah, strahlte so wie der nasse Himmel, der mit den Tröpfchen des Lichts verzaubert war – egal ob noch die Blitze vor schwarzem Hintergrund zuckten oder schon das zarte Blaurosa der Sonne über die Wolken gewandert kam.
*Ferenc Móra (ungarisch Móra Ferenc, * 19. Juli 1879 in Kiskunfélegyháza; † 8. Februar 1934 in Szeged) war ein ungarischer Schriftsteller, Journalist, und Museumskundler. Er gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der ungarischen Literatur. Ferenc Móra stammte als Sohn des Kürschners Márton Móra und der Bäckerin Anna Juhász aus einfachen Verhältnissen. Trotz dieser finanziellen Voraussetzungen seiner Familie brachte er es zu einer abgeschlossenen Schulausbildung und studierte anschließend in Budapest an der Loránd-Eötvös-Universität (ELTE) Geographie und Geschichte. Er arbeitete danach ein Jahr lang als Lehrer in Felsőlövő, damals Komitat Vas (Eisenburg) (heute Oberschützen, Burgenland, Österreich).
Copyright am Text: Anne Schäfer-Junker, Berlin, 2009
e-Mail: info@aujourd-hui.de
|
|
Virtuelle Ausstellung
"Venedig aus dem Wasser gebaut"
Anne Schäfer-Junker, Fotos: Venedig 1993
Daß Licht uns verzaubern kann oder anders ausgedrückt: daß Licht die Welt um uns und in uns verzaubert, hat mich bis heute beschäftigt. So war auch diese Reise nach Venedig Anfang der 90er Jahre mit „meiner Entdeckung des Lichtes“ verbunden. Aber noch viel mehr fand ich dort einen Zugang zu den Augen der Menschen, um zu lernen, wie sie ihre im Wasser gebaute Stadt sahen. Ich unternahm so oft wie möglich Fahrten auf den Kanälen und in die weiteren Landschaften der Lagune, bis nach Burano, Murano und Togliatti. Und immer war es meine Reise zum Licht! Nicht nur bei den Muraner Glasbläsern, wo Fotografieren fast nicht möglich war, weil sie von ihrem eigenen Licht des Glasschmelzofens wohl nichts abgegeben wollten oder konnten, sondern auch bei den Frauen in Burano, die das Licht in ihre wunderschönen Decken einwirkten und so fingerfertige Handwerkstechniken beherrschten, das jedes Textilwerk ein Kunstwerk wurde. Doch auch das Licht auf den Wassern der Kanäle überraschte mich, es färbte die Wasser mal Grün, mal Grau und mal schien die Sonne an den Wänden der Palazzi entlang und die Wellen spiegelten sich an den vom Wasser erodierten Gemäuer und auf den abgenagten blanken Steinen. Und eine unstillbare Neugier, suchende Gespanntheit, die unzähligen schönen und traurigen Lichteinfälle und Farb-Atmosphären mit meiner Spiegelreflex-Kamera zu erwischen, hatte mich erfaßt. Diese würde mich nach den Wassern von Venedig und der Schönheit seiner Palazzi bis an mein Lebensende begleiten und mir immer die Erinnerung an Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien wach halten. Diese schrieb er in nicht all zu weiter Entfernung von Venedig, in der Landschaft der Triestiner Bucht bei Duino: „denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen...“.
Die Schwarz-Weiß-Box aber wird immer das Hohe Lied von allem sein müssen, denn Farbe ist erst in ihrer Umwandlung in unendliche Grauzonen zum unergründlichen Geheimnis geworden.
Mit Dank Helga Wilfroth, Leina, gewidmet.
Geschrieben für die Ausstellung „Venedig: Aus dem Wasser gebaut“, in Gotha vom 17. Juni bis 14. Juli 2006,
überarbeitet: Berlin 22.2.2009
|